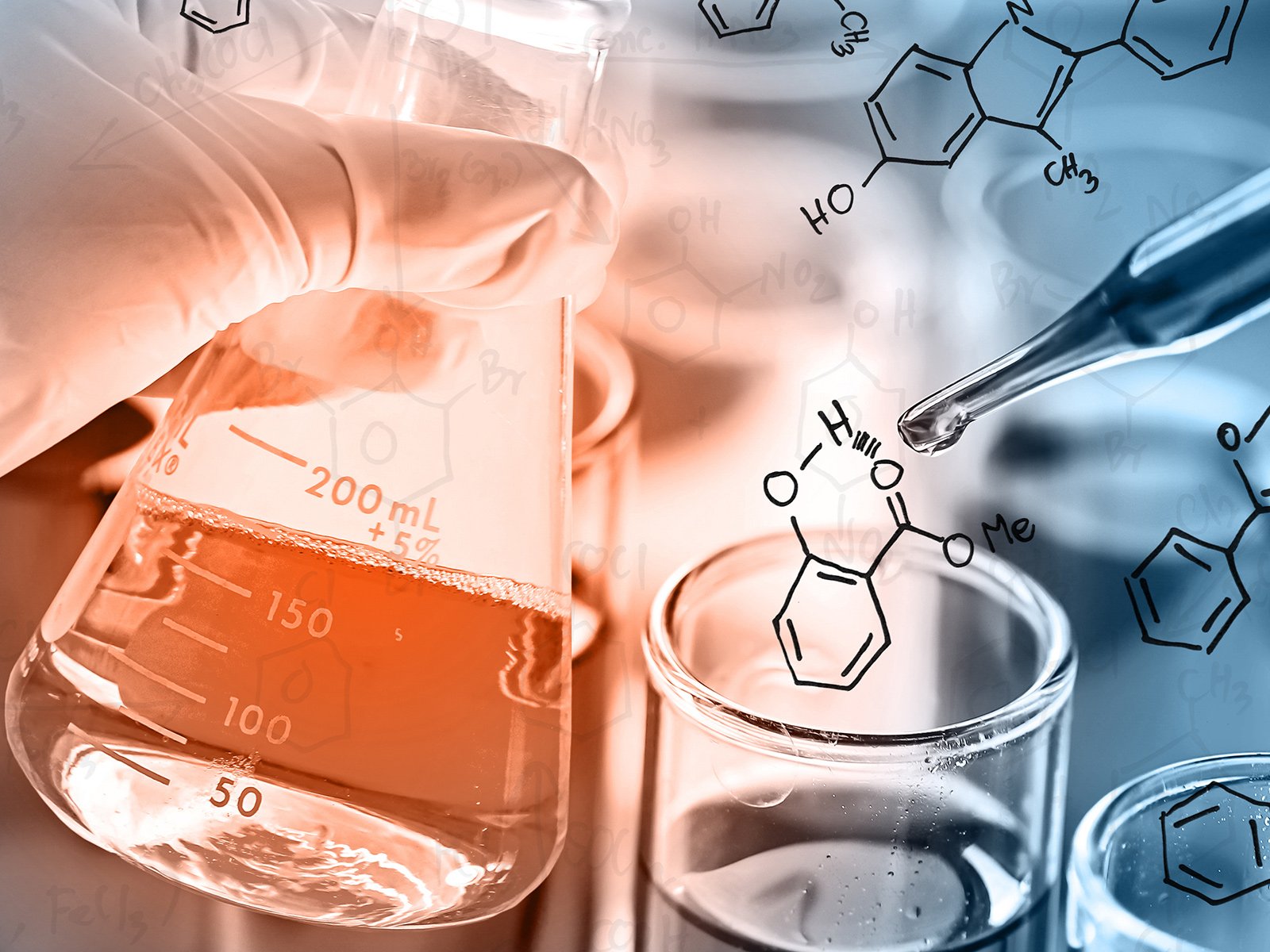So werden Kinder Genießer
Kinder sind von Geburt an kompetente Esser. Und doch müssen sie vieles noch lernen. Das oberste Ziel dabei: Sie sollen genussfähige, entspannte Esser werden. Und natürlich auch gesunde.
Babys verfügen von Geburt an über zwei wesentliche Esskompetenzen: Sie spüren, wann sie hungrig und wann sie satt sind, und sie erkennen, ob ihnen etwas schmeckt oder nicht. Von Anfang an sind Eltern also gefordert, diese beiden Kompetenzen zu respektieren und zu erhalten. Doch was so einfach klingt, stellt für die meisten eine große Herausforderung dar. Also wie nehmen Kinder Geschmäcke wahr und wie kann ihr Geschmackssinn gefördert werden?
Der evolutionäre Rucksack
Die Geschmacksbildung beginnt, wie man mittlerweile weiß, schon im Mutterleib. Das Ungeborene schluckt laufend Fruchtwasser und kommt so mit den Aromen aus der mütterlichen Ernährung in Berührung. Je vielfältiger die Schwangere isst, desto eher werden dem Kind später verschiedene Geschmacksrichtungen vertraut sein und desto eher wird es sie mögen. Man spricht hier von In-utero-Programmierung.
Aber selbst wenn sich Schwangere abwechslungsreich ernähren, ist allgemein bekannt: Kinder lieben Süßes. Tatsächlich ist die Vorliebe für die Geschmacksrichtung süß angeboren. Übrigens auch jene für umami und fett, während alle Babys bitter und sauer ablehnen. Salzig wird ab etwa vier Monaten und in kleinen Mengen akzeptiert.
Die Erklärung liefert der Blick auf die Menschheitsgeschichte: Süß schmecken Muttermilch und reife Früchte, umami deutet auf Eiweiß hin, das für das Wachstum unerlässlich ist. Fett bedeutet energiereich. Bitter hingegen Gefahr, da die meisten Gifte bitter schmecken. Sauer deutet auf Unreife hin. Und die Mineralstoffe in Salzigem sind in geringen Mengen lebensnotwendig. In diesem Lichte betrachtet wird sonnenklar, warum Kinder Ketchup so lieben: Es vereint umami, süß und salzig – ein Jackpot im kindlichen Geschmacksuniversum! Sauer und bitter hingegen müssen Kinder erst mögen lernen. Dieser evolutionäre Geschmacksrucksack sicherte der Menschheit über lange Zeit das Überleben.

Kinder essen sinnlicher
Wir schmecken aber nicht nur fünf Geschmacksrichtungen, wir schmecken auch mit allen fünf Sinnen – Kinder viel mehr als Erwachsene. »Bei Kindern ist die Sensorik stärker ausgeprägt«, beobachtet nicht nur Spitzenkoch Heinz Reitbauer. Die Zunge schmeckt süß, sauer, bitter, umami und fett, Aromen laufen vor allem durch die Nase. Für Kinder sind die Augen ganz entscheidend: Farben, Ordnung oder Unordnung auf dem Teller können über »Mmmmh!« oder »Igitt!« entscheiden. Oder der Tastsinn, wie sich etwas im Mund anfühlt: Stückige Gemüsesuppen etwa finden meistens weniger Anklang als fein pürierte.
Selbst das Hören spielt eine Rolle: Dass viele Kinder rohe Karotten lieber essen als gekochte, liegt auch am Knacken beim Hineinbeißen. Und dann gibt es noch ein Phänomen, das die Geschmacksentwicklung entscheidend beeinflusst: den Effekt der bloßen Darbietung (»Mere-Exposure-Effekt«). Kinder – übrigens auch Erwachsene – essen nicht nur oft, was sie gerne essen, sondern sie lernen auch zu lieben, was sie oft essen oder zumindest kosten. »Oft« bedeutet in der Praxis acht- bis 16-mal.
Emotionen, Gesellschaft, Kultur: Essen ist so vieles!
So viel zu den körperlichen Voraussetzungen für die Geschmacksentwicklung. Damit ist aber längst noch nicht alles erklärt. Essen hat auch soziale, kulturelle, religiöse und emotionale Aspekte. Und auch hier gibt es jede Menge zu lernen: dass es nicht nur den körperlichen, sondern auch den seelischen Hunger stillt, an der Mutterbrust zu trinken, dass es sich gut anfühlt, wenn die ganze Familie gemeinsam zu Abend isst. Dass man Hunger nicht sofort befriedigen muss, sondern mitunter ein bisschen warten kann, bis die Mahlzeit fertig ist. Dass man nicht jeder Versuchung nachgeben darf und Verzicht das Genusserlebnis steigern kann.
So viel zu den körperlichen Voraussetzungen für die Geschmacksentwicklung. Damit ist aber längst noch nicht alles erklärt. Essen hat auch soziale, kulturelle, religiöse und emotionale Aspekte. Und auch hier gibt es jede Menge zu lernen: dass es nicht nur den körperlichen, sondern auch den seelischen Hunger stillt, an der Mutterbrust zu trinken, dass es sich gut anfühlt, wenn die ganze Familie gemeinsam zu Abend isst. Dass man Hunger nicht sofort befriedigen muss, sondern mitunter ein bisschen warten kann, bis die Mahlzeit fertig ist. Dass man nicht jeder Versuchung nachgeben darf und Verzicht das Genusserlebnis steigern kann.

Kleinkinder durchleben fast immer eine Phase, in der sie alles Neue ablehnen – die Wissenschaft nennt es Neophobie – und am liebsten wochenlang Nudeln essen würden. Das passiert zumeist in emotional turbulenten Zeiten, wenn etwa ein neues Geschwisterchen da ist oder der Kindergarten losgeht. Der Rückzug auf vertrautes Essen gibt Sicherheit. Umgekehrt lernt der kleine Mensch sich selbst durch die Grenzen seiner Eltern kennen. Leider reagieren wir Eltern besonders unentspannt, wenn sich das Neinsagen im Bereich Essen abspielt. Dabei haben wir allen Grund zur Gelassenheit: Ein gesundes Kind nimmt keinen Schaden von solchen Es(s)kapaden!
Ganz wesentlich beim Essenlernen sind Vorbilder. Das sind zunächst die Eltern, später auch Pädagogen im Kindergarten und in der Schule. Sie lehren das Kind, was und wie es essen soll. Dabei passiert viel mehr auf der unbewussten als auf der bewussten Ebene. Das gesprochene »Das schmeckt und tut gut!« kommt viel weniger an als das gelebte »Ich-esse-selbstverständlich-Gemüse-und-es-schmeckt-mir.« Spätestens im Jugendalter übernehmen die Freunde diese Funktion. Bevorzugt wird, was sie mögen, gegen die Eltern wird nicht selten auch beim Essen rebelliert. Entspanntes Abwarten ist hier gefragt und das Vertrauen, dass Hans sich später darauf rückbesinnt, was er als Hänschen gelernt hat.
Schließlich gehört zum Essenlernen auch Kultur. In unserem Kulturkreis isst man mit Messer und Gabel, in jeder Familie gibt es Tischregeln, wir essen keine Insekten und Hunde, dafür aber Schwein. Und auch Kochen und Backen sind Teil der Ernährungsbildung – oder sollten es sein (siehe Infobox links).
Vorsicht vor »gesund«
Das Einzige, was Kinder nicht zu lernen brauchen, ist das Konzept »gesund«. Lebensmittel in »gesund« und »ungesund« einzuteilen ist sinnlos und kontraproduktiv. Erstens ist Kindern Gesundheit eine Selbstverständlichkeit, kein Zustand, den man anstreben muss. Zweitens führt ein Verbot von »Ungesundem« ziemlich sicher zu Widerstand. Der wiederum verringert ihre Offenheit, Neues zu probieren. Und drittens gibt es – auch für Erwachsene – keine »gesunden« und »ungesunden« Lebensmittel. Wie immer macht die Dosis das Gift!
Schule des Essens
Ernährungsbildung kommt in der Schule leider viel zu kurz. Und viel zu oft ist von »gesund« und »ungesund« die Rede. Hier hakt die »Schule des Essens« ein, ein Ernährungsbildungskonzept des Forschungsinstituts für biologische Landwirtschaft (FiBL). Die Schüler besuchen Produzenten, absolvieren Einkaufsrallyes, erarbeiten spielerisch Informationen und vor allem: Sie kochen und backen! Zentraler Lernort der »Schule des Essens« ist die Küche.
Bei den praktischen Aktivitäten empfinden die Kinder Lust und Freude, und ganz nebenbei lernen sie jede Menge – im Idealfall das gesamte Themenspektrum rund ums Essen und die Kulturtechnik des Kochens. Damit haben sie das Rüstzeug, mündige Konsumenten und gesunde Genießer zu werden.
In den vergangenen zwei Jahren lief die »Schule des Essens« erfolgreich an drei Pilotschulen in Wien und Niederösterreich. Wenn alles nach Plan läuft und die Finanzierung aufgebracht werden kann, soll das Projekt in Bälde auf zwanzig Schulen in ganz Österreich ausgedehnt werden. Die Zukunftsvision ist ein Schulfach »Essen« für alle Kinder und Jugendlichen von der ersten Klasse bis zum Ende ihrer Schulzeit.