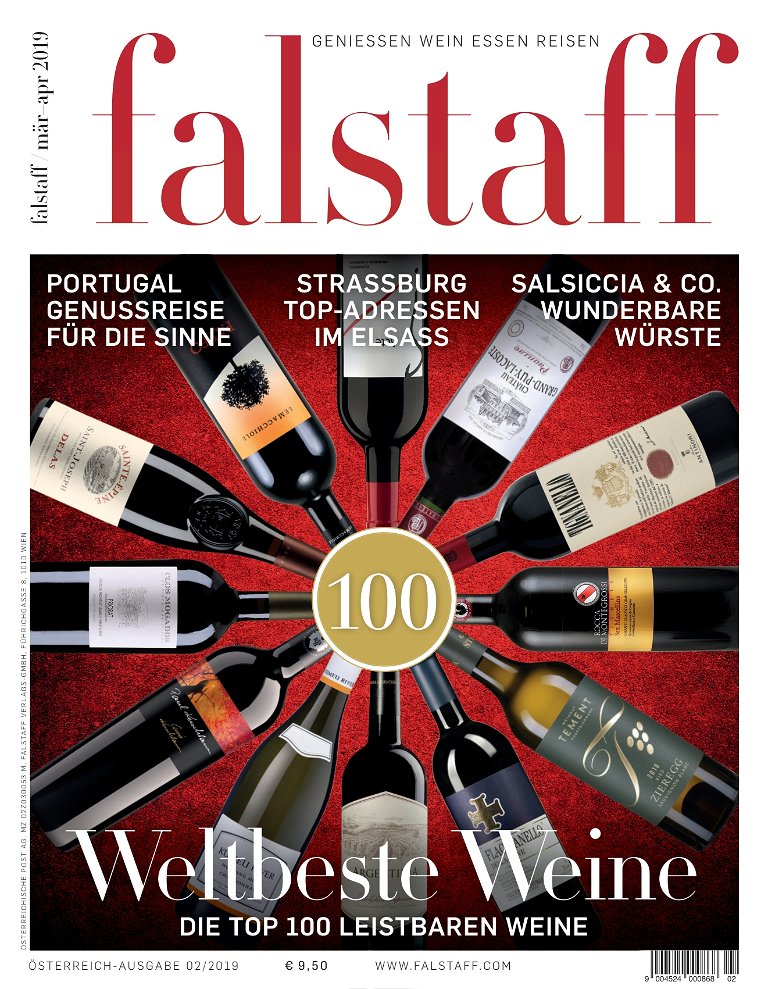Essay: Wie Grünkohl Karriere machte
Es ist nur wenige Jahrhunderte her, da war Hummer ein Arme-Leute-Essen. Heute zählt es als Luxusgut. Wie kommt es, dass manche Lebensmittel so rasant aufsteigen?
Oh Gott, nein, bitte nicht schon wieder Hummer! Einen solchen Ausruf hörte man zu Kolonialzeiten an der amerikanischen Ostküste häufiger. Experten des Bundesstaats Maine zufolge ließen sich Hausangestellte sogar einen Passus in ihren Vertrag schreiben, der lautete: Maximal dreimal pro Woche Hummer als Mahlzeit.
Ja, Sie haben richtig gelesen: Das, was wir heute teuer in guten Restaurants bezahlen, galt vor wenigen Jahrhunderten als Arme-Leute-Essen und kam den verknechteten Arbeitern wieder aus den Ohren heraus. In Schottland existieren historische Rezepte für Hummer über Torffeuer, sagt der deutsche Biologe Andreas Scharbert, was ebenfalls auf die Arbeiterklasse hindeutet, die sich eine einfache Mahlzeit zubereitete. Wie kann sich der Wert eines Lebensmittels so fundamental wandeln?
Essen war in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit nur die kürzeste Zeit dafür da, um satt zu werden. Seit sich menschliche Kultur entwickelt hat, erfüllt es immer auch eine soziale Funktion. Am Essen lässt sich nicht nur der Bildungsstand ablesen, sondern erst recht das Einkommen und der soziale Status. Du bist, was du isst – der alte Spruch ist aktueller denn je.
Wagyu-Steak als Statussymbol
Warum trauen sich nur die wenigsten Spitzenköche, komplett auf Luxuskomponenten wie Kaviar oder fetten Thunfischbauch zu verzichten? Weil Essen eben weitaus mehr ist als bloße Bedürfnisbefriedigung. Erwartungen werden geweckt und befriedigt, Zutaten überhöht, bis es kaum noch um den Geschmack geht, sondern vor allem um die Wirkung. Jede Wette: Ein A6-gemasertes Wagyu-Entrecôte, zu Hause gebraten für die Freundesrunde, erzeugt einen größeren Wow-Effekt als der Porsche vor der Garage.
Lebensmittel unterliegen dem Mechanismus unseres Wirtschaftssystems – und das beruht nun mal auf Angebot und Nachfrage. Was zur einfachen Formel führt: Je seltener, desto teurer und letztlich auch prestigeträchtiger ist ein Lebensmittel. Umgekehrt gilt das Gleiche: Die eingangs erwähnten Zustände waren nur möglich, weil es Hummer an der US-Ostküste im Überfluss gab. Kühlmöglichkeiten für lebende Ware gab es noch nicht, Transportwege ins Landesinnere existierten nur spärlich und die Konservenindustrie war noch nicht erfunden. Mit dem Aufkommen der Dose um 1840, das belegen Aufzeichnungen des Bundesstaats Maine, ging der Hummerbestand binnen weniger Jahrzehnte massiv zurück – die Grundlage für die spätere Aufwertung.
Zutaten werden überhöht, bis es kaum noch um den Geschmack geht, sondern vor allem um die Wirkung.
Fische und Meeresfrüchte sind ein gutes Beispiel, weil sie sich trotz großer Anstrengungen noch nicht im gleichen Maße züchten lassen wie Rind, Schwein und Huhn. Die natürliche Umgebung spielt hier eine wichtigere Rolle – und die lässt sich vom Menschen nur indirekt steuern. Überfischung und teilweise auch Umweltverschmutzung führte in vielen Fällen dazu, dass das Angebot immer knapper wurde und sich manchmal sogar ganz erschöpfte. Etwa beim Stör: Er war früher nicht nur in russischen Gewässern, sondern in ganz Europa zu Hause – an Kaviar bestand kein Mangel. Russische Bars boten kostenlos Blinis mit Kaviar an, die als salziges Häppchen Lust auf noch einen Drink machen sollten – die Kartoffelchips des 19. Jahrhunderts. Mit zunehmender Überfischung und weil der Stör erst im hohen Alter geschlechtsreif wird, nahm die Zahl der Fische ab – und damit auch das Angebot an Stör-Kaviar. Je weniger es davon gab, desto teurer wurde er.
Etliche Mahlzeiten, die früher als Arme-Leute-Essen galten, haben im hedonistisch geprägten 20. Jahrhundert den Aufstieg geschafft. Sei es Pizza, die armen Neapolitanern ursprünglich zur Resteverwertung diente, oder Sushi: Mit zunehmender Individualisierung und einer Aufwertung der Zutaten wurden auch diese Speisen (zumindest in gewissen Umgebungen) aufgeladen und überhöht.
Der Trend unserer Zeit zur gesunden Ernährung verhalf einem lange unbeliebten Lebensmittel zu besserem Ansehen. Bis vor einem Jahrzehnt vor allem geeignet, um Kinder zu ärgern, gehört Grünkohl heute zum »Superfood«. 2009 kamen in den USA erstmals »Kale«-Chips auf den Markt. Medien berichteten über den gesundheitlichen Wert von Grünkohl, von Vitaminen, Eisen und Mineralstoffen. Auf einmal war »Kale« cool unter New Yorks Hipstern, und es dauert nicht lange, bis der Hype auch über den Ozean schwappte. Der Zeitgeist spielte hier die entscheidende Rolle: gesundes Essen, dargeboten in anderer Form als bisher, nämlich als Chips oder im Smoothie. Heute würde man sagen: ein gelungenes Rebranding.